Zahlungsauslösedienste
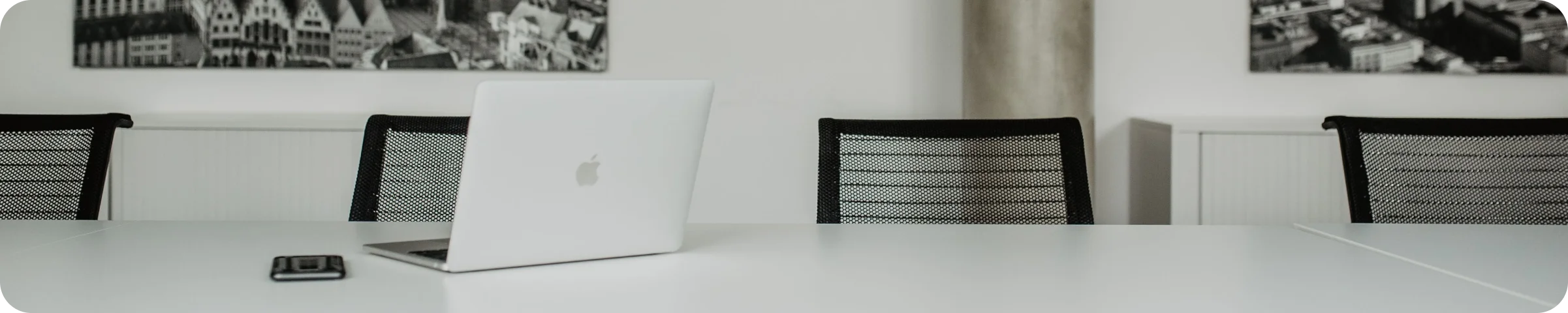
- Finanztransfergeschäft
- Zahlungsauslösedienste
- Kontoinformationsdienste
- E-Geld Geschäft
- Handelsvertreterausnahme im ZAG
- Begrenzte Händlernetze und Closed Loop
Zahlungsauslösedienste als regulierte Tätigkeit nach dem ZAG
Seit Umsetzung der Vorgaben der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) in das deutsche Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) sind auch sog. Zahlungsauslösedienste erlaubnispflichtige Tätigkeiten, für die Unternehmen eine BaFin Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 ZAG einholen müssen. Mit der Einführung von Zahlungsauslösediensten wollte der europäische Richtliniengeber neu entstandene Zahlungsdienste im Internet einer Beaufsichtigung unterstellen, bei denen der Dienstleister von seinem Kunden dazu ermächtigt wird, eine Zahlung von dessen Zahlungskonto zu veranlassen, ohne selbst in den Besitz der transaktionsgegenständlichen Gelder zu gelangen. § 1 Abs. 33 ZAG definiert Zahlungsauslösedienste als einen Dienst, bei dem auf Veranlassung des Zahlungsdienstnutzers ein Zahlungsauftrag in Bezug auf ein bei einem anderen Zahlungsdienstleister geführtes Zahlungskonto ausgelöst wird. Gegenstand der regulierten Tätigkeit ist die Übermittlung von Zahlungsaufträgen an kontoführende Zahlungsdienstleister für den Kunden. Erforderlich ist insoweit, dass der Zahlungsauslösedienstleister insoweit Zugriff auf das Zahlungskonto des Kunden erhält, dass er für ihn einen Zahlungsauftrag final gegenüber dem kontoführenden Institut erteilen kann, der dann durch das beauftrage Zahlungsinstitut ausgeführt wird. Nicht als Zahlungsauslösedienstleister sind demgegenüber reine technische Dienstleister erfasst, die lediglich eine Autorisierungsanfrage nebst Datensatz mit Transaktionsdetails an das kontoführende Institut ihres Kunden übermitteln. In diesen Fällen wird der Zahlungsvorgang durch den Beitrag des Dienstleisters nicht ausgelöst, sondern lediglich zur Ausführung angefragt, es fehlt an dem für die Tatbestandsmäßigkeit erforderliche Zugriffsmöglichkeit des Dienstleisters auf das Zahlungskonto. Entsprechend liegen Zahlungsauslösedienste in der Regel nicht bei Nutzung des E-BICS Verfahrens oder des SEPA-Lastschriftverfahrens vor.
Haftungsabsicherung und Eigenmittelanforderungen für Zahlungsauslösedienstleister
Reine Zahlungsauslösedienstleister, die neben Zahlungsauslösediensten keine sonstigen beaufsichtigten Zahlungsdienste erbringen, haben im Hinblick auf das vorzuhaltende Mindestkapital und die finanzielle Ausstattung einige Vorteile gegenüber den übrigen Zahlungsinstituten, da sie ein abweichendes Risikoprofil haben. Da reine Zahlungsauslösedienstleister keine Kundengelder entgegennehmen, sondern lediglich Zahlungsaufträge an kontoführende Zahlungsinstitute übermitteln, haben sie lediglich ein regulatorisches Mindestkapital von 50.000 Euro vorzuweisen, das stets vorhanden sein muss. Im Hinblick auf die für Zahlungsinstitute geltende Eigenmittelausstattung nach der ZIEV besteht die Besonderheit, dass reine Zahlungsauslösedienstleister neben dem regulatorischen Mindestkapital von 50.000 Euro keine darüber hinausgehende Eigenmittelausstattung gegenüber der BaFin nachweisen müssen. Diesen Betrag erkennt die ZIEV für sie als angemessene Eigenmittelausstattung an. Erforderlich ist jedoch praktisch als Ersatz für die Befreiung von zusätzlichen Anforderungen nach der ZIEV, dass reine Zahlungsauslösedienstleister sich mit einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie gegen Haftungsfälle aus der Erbringung der Zahlungsauslösedienste absichern. Der Versicherer muss dabei ein für den Geschäftsbetrieb im Inland befugtes Versicherungsunternehmen sein, so dass grundsätzlich auch ausländische Versicherer in Betracht kommen, die beispielsweise im Wege des grenzüberscheitenden Dienstleistungsverkehrs i.S.v. §§ 61ff. des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) tätig sind.
Banken müssen Nutzung von Zahlungsauslösediensten ermöglichen
Seit Umsetzung der PSD2 in das ZAG steht fest, dass Banken ihren Kunden die Nutzung von Zahlungsauslösedienstleistern ermöglichen müssen. Nach § 48 ZAG sind kontoführende Institute verpflichtet, über Zahlungsauslösedienstleister erteilte Zahlungsaufträge auszuführen. Sie sind verpflichtet, mit dem Zahlungsauslösedienstleister sicher zu kommunizieren, ihm alle erforderlichen Informationen über die Ausführung mitzuteilen und hinsichtlich der zeitlichen Abwicklung, Priorisierung und Entgelte keine Unterschiede im Vergleich mit klassisch erteilten Zahlungsaufträgen zu machen. § 48 Abs. 2 ZAG stellt klar, dass kontoführende Banken die Ausführung von über Zahlungsauslösedienstleister erteilte Zahlungsaufträge nicht mit dem Argument ablehnen können, dass zwischen ihnen und dem Zahlungsauslösedienstleister kein Vertrag bestünde. Ein solcher ist nach dem Gesetz nicht erforderlich. Die Verweigerung des Zugriffs auf ein Kundenkonto ist für eine kontoführende Bank gemäß § 52 ZAG nur möglich, wenn der objektive und nachgewiesene Verdacht vorliegt, dass der Zahlungsauslösedienstleister ohne ordnungsgemäß erteilte Autorisierung des Kunden handelt. In solchen Fällen ist das kontoführende Institut verpflichtet, den Vorfall unverzüglich der BaFin zu melden, die ihrerseits dann über die Ergreifung aufsichtsrechtlicher Maßnahmen und die Unterrichtung anderer Behörden wie insbesondere der Strafverfolgungsbehörden zu entscheiden hat.
Zuständiger Anwalt für die Beratung zur Einholung einer Erlaubnis nach dem ZAG für die Erbringung von Zahlungsauslösediensten und zu allen vertrags- und aufsichtsrechtlichen Fragen im Zahlungsdiensterecht in unserer Kanzlei ist Rechtsanwalt Dr. Lutz Auffenberg, LL.M. (London).



